Keine Schusterflecken: Eleonore Büning verführt den Leser, Beethoven hören zu wollen



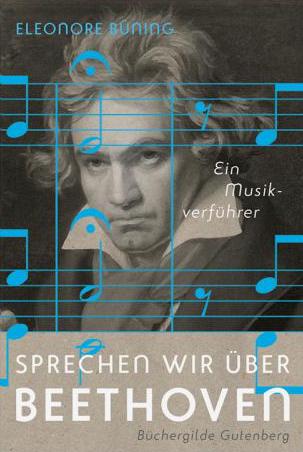
| Info |
Autor: Eleonore Büning

Titel: Sprechen wir über Beethoven. Ein Musikverführer

Verlag: Büchergilde Gutenberg

ISBN: 978-3-7632-7194-8

Preis: € 24

325 Seiten

| |
|

Wohl kein Komponist ist über die Jahrhunderte aus so vielen Richtungen „vereinnahmt“ worden wie Ludwig van Beethoven. Diese Aussage soll ebenso multipel verstanden werden, denn nicht nur musikalisch führen seine Spuren in völlig unterschiedliche Genres weiter, auch gesellschaftlich und politisch konnten selbst konträre politische Systeme wie der Nationalsozialismus, der real existierende Sozialismus der DDR und das, was wir heute mit der Worthülse „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ beschreiben, Nutzen aus der Musik des 1770 geborenen Bonners ziehen.
Besagtes Geburtsjahr bedeutet, dass 2020 das 250. Jubiläum der Geburt des kleinen Ludwig II. (Vater Beethoven hatte schon seinem Vorgängerkind den Namen Ludwig gegeben, aber das war noch als Baby gestorben, so dass der spätere Komponist den Namen in Zweitverwendung bekam) anstand – durch die pandemische Situation fiel allerdings ein Großteil der entsprechenden Aktivitäten aus. Aber da Beethoven schon 1827 mit 56 Jahren starb, steht uns 2027 bereits das nächste Gedenkjahr ins Haus, und wenn dann nicht wieder neue Mißhelligkeiten auftreten, dürfte mit einer ungebändigten Flut von Aktivitäten zu rechnen sein, die vielleicht auch dazu führt, dass man sich mal den diversen selten bis nie aufgeführten Werken des Bonners und späteren Wieners widmet. Bei einem Komponisten vom Range Beethovens verwundert eigentlich, dass es solche überhaupt gibt – aber sie sind da, sogar recht zahlreich und keineswegs nur unter den WoO, also den Werken ohne Opuszahl, zu finden.
Das hier vorgestellte Buch ist nur indirekt ein mit dem weitgehend ausgefallenen Jubiläumsjahr 2020 zusammenhängendes Produkt. Eleonore Büning, vielen bekannt als jahrzehntelange Musikkritikerin der FAZ, hatte 2015 für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) eine Sendereihe erstellt, die schlicht „Beethoven“ hieß und deren 26 Teile nun die 26 Kapitel des vorliegenden Buches bilden, von der Sende- in die Lesefassung umgewandelt allerdings nicht von Büning selbst, sondern von Fritz Jensch. Das resultierende Buch erschien dann 2018 im zum Red-Bull-Imperium zählenden Benevento-Verlag, und 2020 (da haben wir dann den Bezug zum Jubiläum) brachte die Büchergilde Gutenberg zum gleichen Preis eine Lizenzausgabe heraus. Der Rezensent besitzt nur letztere, nicht die Benevento-Ausgabe und kann daher zu eventuellen Unterschieden in Inhalt oder Ausstattung nichts sagen. Die Büchergilde-Version kommt jedenfalls im Festeinband mit Schutzumschlag, wobei der Inhalt fast komplett auf Bilder verzichtet – die einzigen Abbildungen sind an bestimmten Stellen plazierte Notenbeispiele, die z.B. bestimmte musikalische Themen zeigen.
Eleonore Büning hat bereits ihre Dissertation an der Freien Universität Berlin über Beethoven geschrieben (1992 auch in Buchform unter dem Titel „Wie Beethoven auf den Sockel kam“ erschienen und sich mit der frühen Beethoven-Rezeption befassend) und ist seinem Werk natürlich auch in ihrer medialen Karriere immer und immer wieder begegnet, so dass sich ein sehr großer Wissens- und Erfahrungsschatz aufgebaut hat, von dem ein solches Buch selbstredend enorm profitiert. Der Untertitel „Ein Musikverführer“ sagt nämlich bereits, dass es sich hier nicht etwa um die schätzungsweise 274. Beethoven-Biographie handelt, und auch ein kommentiertes Werkverzeichnis ist es nicht geworden, sondern eine Art populärwissenschaftlicher Mix aus beidem, der einerseits tonnenweise Informationen aus Beethovens Leben auffährt, aber zugleich das Wirken anhand konkreter Beispiele reflektiert und den Leser praktisch dazu verführen will, von dort aus selber ins Schaffen des Komponisten vorzudringen. Die Audio-Arbeit muß der Leser des Buches dabei komplett selbständig leisten – die Radioserie war natürlich mit diversen Musikausschnitten ausgestattet, die hier nunmehr fehlen, wobei die Autorin aber zu bestimmten Werken und Einspielungen Einschätzungen abgibt, was man von jenen erwarten kann. Dass sie fachlich über den Dingen steht, war dabei zu erwarten, und dass sie auch in der Lage ist, ihr Wissen kompakt und doch ausführlich in verständlicher Weise zu transportieren, stellt ebenso keine Überraschung dar (sowas muß man als Rezensent einer Tageszeitung halt können – der hier tippende Rezensent mit seiner Neigung zu ausschweifenden Analysen wäre für diesen Job wohl nicht ganz so geeignet). Ob sie in allen Fällen jeweils den neuesten Forschungsstand wiedergibt, vermag der Rezensent, der in der Beethoven-Forschung nicht „am Puls der Zeit“ sitzt, über weite Strecken nicht einzuschätzen. Als etwas unglücklich aufgefallen ist ihm indes der Passus auf S. 233 über die Tradition, die Neunte zu Silvester zu spielen. Das geschah, wie die Autorin richtig bemerkt, erstmals 1918 unter Arthur Nikisch im Rahmen der „Friedens- und Freiheitsfeier“ in Leipzig – die von ihr angedeutete Tradition wurde aber dort erst viele Jahre später daraus: Die vom Arbeiter-Bildungs-Institut organisierten, zumeist vom Gewandhausorchester bestrittenen Silvesterkonzerte fanden zwar bis 1932 jährlich statt, aber die Neunte wurde in ihnen nach 1918 nur noch ein einziges Mal aufgeführt. Erst 1945 begann dann in Leipzig die Tradition, zu Silvester die Neunte zu spielen, und wurde mit Ausnahme von 1947 und 1984 auch konsequent durchgezogen. Bei ihrer Version der Geschichte sitzt die Autorin einer alten Ente aus den 1960ern auf, die sich durch weite Teile der Literatur zieht und die Entstehung dieser Tradition eben der Leipziger Arbeiterbewegung nach dem Ersten Weltkrieg zuschreiben wollte. Claudius Böhm hat in der Herbstausgabe 2018 des Gewandhaus-Magazins diese Ente als solche entlarvt, so dass also zumindest in der 2020er Lizenzausgabe des Buches oder auch schon in der 2019 erschienenen zweiten Auflage der Benevento-Edition eine Korrektur oder zumindest Präzisierung hätte stattfinden können. (Dass letztere, dem Rezensenten nicht vorliegende eine entsprechende Änderung hat, die dann aber in der Lizenzausgabe des Folgejahres wieder entfallen ist, dürfte kaum wahrscheinlich sein.)
Der Schreibstil läßt sich sehr angenehm lesen und ist in einer Art fachlich fundiertem Plauderton gehalten, wobei Jensch bei der Verschriftlichung gute Arbeit geleistet hat und sich die Zahl der Problemfälle in erfreulich geringer Zahl hält. An einige etwas unmotiviert gestaltete grammatikalisch inkomplette Sätze muß man sich freilich gewöhnen, wobei der Rezensent kein regelmäßiger Leser von Bünings Rezensionen war und daher nicht sagen kann, ob das ein ihr eigenes Stilmittel ist oder ob Jensch dafür verantwortlich zeichnet. Eigenartig mutet auch das Prinzip an, bei mehreren Vornamen französischer Komponisten auf den Bindestrich zu verzichten, was die nahezu komplette dem Rezensenten bekannte Musikliteratur anders handhabt.
Die 26 Kapitel sind jeweils mit einem Auszug aus einem historischen Zitat überschrieben (manchmal von Beethoven selbst stammend) und folgen grundsätzlich einem gewissen chronologischen Prinzip, das aber geschickt mit thematischen Bezügen verwoben ist, so dass man zwar die zeitliche Lebenslinie erkennt, aber von dieser immer wieder weggeführt wird, um bestimmte inhaltliche Kontexte zu ermöglichen. Das ergibt angenehmerweise kein Chaos und nur in einigen wenigen Fällen leichte Verwirrung, etwa wenn man auf S. 12 „Schusterflecken“ zwar als „langweilige Begleitfiguren“ definiert bekommt, der wienerische kulturhistorische Background dieses eigenartigen Begriffs aber erst etliche hundert Seiten später erklärt wird. Schon das erste Kapitel macht die erwähnte Kombination aus Chronologie und Thema klar, indem es hier einerseits um die Kurfürstensonaten als Jugendwerke, andererseits aber um strukturelle Auffälligkeiten in den letzten Klaviersonaten aus den 1820er Jahren geht, womit die Autorin mal eben das komplette Leben des Komponisten umspannt und das richtig geschickt anstellt. Die neun Sinfonien finden natürlich ihren gebührenden Platz, aber Büning taucht auch nach Perlen, die man kaum in Konzertprogrammen der heutigen Zeit und teilweise nicht mal in halbwegs aktuellen Einspielungen findet. Nur an wenigen Stellen geht die Musikwissenschaftlerin in ihr durch, und die Werkanalyse wird etwas zu weitschweifig und/oder strukturdominiert, wobei es sein kann, dass es sich hier um Passagen handelt, die in der Rundfunkversion noch mit Hörbeispielen ergänzt worden waren und daher der Anschaulichkeitsgrad auch für den durchschnittlichen, zwar klassikinteressierten, aber unspezialisierten Hörer höher lag als für einen gleichartig disponierten Leser. Allerdings setzt Büning ein gewisses Grundwissen beim Leser voraus, nicht nur bezüglich musikwissenschaftlicher Terminologie, sondern auch über geschichtliche Hintergründe etc., so dass „Sprechen wir über Beethoven“ sich eher nicht für Leser eignet, die in diesen Welten noch gar keine oder nur wenig Erfahrung besitzen. Dieser Leserkreis sollte dann wohl eher zu einer der vielen klassischen populärwissenschaftlichen Biographien greifen – Bünings Buch dagegen ist eine Fundgrube für den bereits ein Stück weit fortgeschrittenen Leser, der jenseits einer einfachen biographischen Schilderung ins Werk Beethovens eindringen will, idealerweise auch schon etliche Tonträger besitzt (oder sich kreuz und quer durch die im Netz verfügbaren Aufnahmen hört) und sozusagen die nächste Stufe im Verständnis des Schaffens des Bonners/Wieners erklimmen will, um im nächsten Jubiläumsjahr besser mitreden zu können. Ob man allen Argumentationen der Autorin folgen will oder die eine oder andere Vermutung für leicht abenteuerlich hält, kann man im Zuge der intensiveren Beschäftigung mit dem Sujet Beethoven dann immer noch selbst entscheiden. Was es freilich nicht gibt, ist ein Literaturverzeichnis – man muß sich das Passende für die weitere Vertiefung anhand der Nennungen im Text also selbst zusammensuchen. Dafür endet das Buch mit einem Verzeichnis der im Text behandelten Werke, so dass also die Sucharbeit in dieser Richtung deutlich vereinfacht wird.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, dass das Buch seinen Anspruch, ein Musikverführer sein zu wollen, durchaus erfüllen kann – der Leser bekommt durchaus Appetit, die optisch aufgenommenen Informationen auch akustisch zu verifizieren. Da es die originale Rundfunksendung vermutlich in keiner Mediathek mehr geben wird, bleibt nur der Weg in den Tonkonservenladen oder an die einschlägigen Stellen des Netzes, aber beide Wege sind in ihrer jeweiligen Ausprägung auf alle Fälle lohnend, und wer noch Anhaltspunkte braucht, der findet auch in den Tonträgerreviews bei MAS eine riesige Anzahl von Tips. Viel Freude!

Roland Ludwig



|
