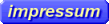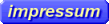25 Years after - Mein Leben mit der CD; Folge 9: Lake - No Time for Heroes




|

Zwei Best of-Scheiben und ein Album von Lake - so sah die CD-Ausbeute des Dezember 1986 aus. Lake waren eine Krautrock-Band, die eigentlich gar keine war. Ihr Stil war immer recht amerikanisch geprägt. Spätestens mit den grandiosen Album Ouuch! hatte sie sich auf eine Ebene mit den großen US-amerikanischen Stadion-Rock-Bands a la Toto oder den 80er Jahre Chicago gebracht. Und obwohl die Band in den USA nicht ganz erfolglos war, konnten die Deutschen da nicht mithalten. Und um der Credibility, die man von einer Krautrock-Band erwartete, gerecht zu werden, waren Lake einfach nicht abgedreht genug.
Nach ihrer Reunion 1984 wurden Lake dann deutlich poppiger, aber das auf einem sehr hohen Niveau.
Das sehr „sonnige“ Album No Time for Heroes erstand ich zu Beginn meines ersten Winters in Berlin. Und das ist Anlass genug, mich an meine damalige Behausung in Berlin und auch den Wohnungsmarkt im Westteil der geteilten Stadt zu erinnern.
Die Wohnungssuche, die zu diesem Zeitpunkt bereits ein Vierteljahr zurück lag, gestaltete sich recht schwer. Es gab in Berlin einfach viel weniger (bezahlbare) Wohnungen, als gebraucht wurden. Für eine erfolgreiche Wohnungsjagd trommelte man, wenn man es „professionell“ anging, nach Möglichkeit mindestens drei Personen zusammen. Zwei von ihnen positionierten sich am Freitagabend an der Ausfahrt des Springer-Gebäudes in Kreuzberg und hofften darauf, dass einer der Transporter-Fahrer, die die noch druckfeuchte Morgenpost auslieferten, bereit war ihnen ein Exemplar auszuhändigen.
Hatte man eine Gazette erwischt, ging es schnell ins Auto. Bereits während der Fahrt wurden die Immobilien-Angebote der Samstag-Ausgabe vom „zweiten Mann“ – in der Regel dem Wohnungssuchenden – studiert. Die Fahrt endete an einer nah gelegenen Telefonzelle, die von dem dritten Mann bereits blockiert war. Von dort (Handies gab es damals noch nicht.) wurden sofort die interessanten Objekte antelefoniert, um nach Möglichkeit der erste Anrufer zu sein.
So kam ich an meine erste Berliner Wohnung im wohl letzten unsanierten Haus des völlig szenefreien Lankwitz. Das Haus mit zwei Aufgängen und etwa 12 Wohneinheiten gehörte einem sturen Senior, der selber eine Wohnung in dem Haus bewohnte. Bei ihm lieferte ich die Mietkaution von drei Monatsmieten ab – und erlebte meine erste Überraschung. Die Quittung bestand aus einem Viertel einer sorgfältig geviertelten Din A4-Seite, auf der in Bleistift (!) stand, dass ich 675 DM Kaution hinterlegt habe. Diesen Akt vollzog ich nun jeden Monat, denn Hausbesitzer Manke war vom alten Schlag und verlangte Barzahlung an jedem Ersten des Monats.
Meine Wohnung bestand aus anderthalb Zimmern, Küche und Toilette. Aber das muss ich spaßeshalber näher beschreiben. Das eine Zimmer mit Balkon (links) war okay; die Küche (rechts) auch. Der Rest in der Mitte war einmal ein eigenes Zimmer mit einem vierflügeligen Fenster gewesen – zwei große Flügel unten; zwei kleine oben. Dieses Zimmer hatte man mit einer Zwischenwand geteilt, die genau rechts neben den linken Fensterflügeln auf die Hauswand stieß. Ich hatte also auf der linken Seite ein extrem schmales Zimmer mit einem halben Doppelfenster.
Der rechte Raum war noch einmal geteilt. Eine quer im Raum stehende Wand teilte ein etwa ein Meter langes Stück am hinteren Ende ab. Eine Tür zur Küche gab ihm die Rolle einer Speisekammer. Diese Kammer hatte eine zusätzliche Decke zwischen dem oberen und unteren Flügel der rechten Fensterhälfte. (Wegen Wand und Zwischendecke mussten die ursprünglichen Fensterflügel natürlich durch kleinere Flügel ersetzt werden.)
Da die eingezogene Zwischenwand am Ende des vorderen Teils der zweiten Zimmerhälfte nur bis zur Höhe der Zwischendecke reichte, hatte dieser Teil - oberhalb der Speisekammer - Zugang zum oberen Fensterflügel, der mittels einer langen an ihm befestigten Metalstange geöffnet werden konnte.
Ein wichtiges Detail. Denn in diesem mit dickem Teppichboden(!) bedeckten Raum befand sich das nicht ganz dichte Toilettenbecken. Die Kombination von Undichte des Klos und saugfähigem Teppichboden machte die Möglichkeit zum Lüften nahezu zur Überlebensfrage.
Hier also verbrachte ich meinen ersten, extrem kalten Winter in Berlin – in einer Wohnung, die am Ende des Hauses lag und so drei Außenwände hatte und unter der sich ein Keller befand, der oberhalb der Erde lag – ideale Bedingungen zum Auskühlen.
Und diese Wohnung wurde mit einem kleinen Allesbrenner im Wohnzimmer und einem Herd in der Küche mit Kohle beheizt – von einem Bewohner, der durchaus davon gelesen hatte, dass es einmal Zeiten gegeben haben soll, in denen man mit Kohle geheizt hat, der aber noch nie selber einen Ofen in Betrieb gehalten hatte.
Die Folgen?:
Ich, der ich normalerweise auch im tiefsten Winter unter dem Sommerbett schlafe, ging mit zwei Schlafanzügen und sämtlichen im Hause befindlichen Decken ins Bett.
Hatte ich am Abend vergessen den Kaffeefilter aus der Maschine zu nehmen, musste das erste gekochte Wasser dazu dienen, den gefrorenen Kaffeesatz von der Maschine zu lösen.
Natürlich: Man gewöhnt sich an alles. Und bevor die Mauer gefallen war, hatte das Haus erst als Erbgut, dann als Spekulationsobjekt und letztlich als Ausbauprojekt einiger Ehepaare mehrfach die Besitzer gewechselt. Ich hatte am Ende eine gut sanierte Wohnung, die ich nach meiner Heirat an meinen Halbsohn weiter reichen konnte und mindestens zwei der Ehen der Käufer waren gescheitert.

Norbert von Fransecky



|