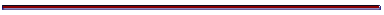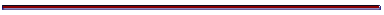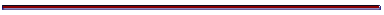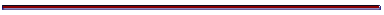Passion: Leiden und Leidenschaft
Eine Aufführung der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach (1685-1750) ergriff den jungen Bertold
Brecht derart, dass er ernstlich um seine Gesundheit fürchtete. Noch 1944, im
amerikanischen Exil, erinnerte er sich daran, dass er den "Stupor"
[= Erstarrung] verabscheut habe, in den man da verfallen sei, "dieses
wilde Koma", von dem er glaubte, dass es seinem Herzen schaden könne.
Eine solch intensives, höchst ambivalentes Erleben von Bachs Musik mag
heute, da das Werk sowohl als ein Gipfelpunkt der abendländischen
Musikgeschichte wie auch im Konzertsaal unverrückbar fest etabliert
und - dementsprechend - auch discographisch in zahllosen Einspielungen,
dokumentiert ist, verwundern. Ist denn diese Musik nicht vor
allem anderen ... schön? Tröstlich? Ergreifend? Fromm?
Doch abseits eines eher kulinarischen Konsums von Bachs Musik und der
Abschleifung ihrer Ecken und Kanten durch Aufführungstradition und
Gewöhnung, zeugt Brechts Äußerung von ihrem Potential, den Hörer nicht
nur psychologisch, sondern geradezu physisch in seiner Existenz zu
erschüttern und zu beunruhigen. Diese Musik lässt sich nicht einfach
vereinnahmen - sie fordert ihren Hörer.
200 Jahre zuvor scheinen Bachs Zeitgenossen das kaum anders empfunden zu
haben:
"Als in einer vornehmen Stadt diese Paßions-Music mit 12 Violinen, vielen
Hautbois [Oboen], Fagots und anderen Instrumenten mehr, zum erstenmal
gemacht ward, erstaunten viele Leute darüber und wußten nicht, was sie
daraus machen sollten. Auf einer Adelichen Kirch-Stube [Empore] waren viele
Hohe Ministri und Adeliche Damen beysammen, die das erste Passions-Lied
aus ihren Büchern mit großer Devotion sungen: Als nun diese theatralische
Music angieng, so geriethen alle diese Personen in die größte Verwunderung,
sahen einander an und sagten: Was soll daraus werden? Eine alte Adeliche
Wittwe sagte: "Behüte Gott, ihr Kinder! Ist es doch, als ob man in einer
Opera-Komödie wäre." - Aber alle hatten ein Mißfallen daran und führten
gerechte Klage darüber."
So zu lesen in Christian Gerbers "Historie der Kirchen-Ceremonien in
Sachsen" aus dem Jahr 1732; Mit despektierlichem Unterton äußert der Autor
an anderer Stelle: "Es gibt aber freilich auch solche Gemüter, die
an solchem eitlem Wesen ein Wohlgefallen haben, zumal wenn ihr Temprament
sanguinisch [= leicht erregbar] und zur Wollust geneigt ist." Erregung
und Wollust! So reizvoll die Vorstellung rezeptionsgeschichtlich auch
sein mag: Dass Gerbers Spitze tatsächlich gegen Bachs Matthäuspassion
gerichtet war, ist eher unwahrscheinlich. Als O-Ton der Zeit ist sie für
die konservative Erwartungshaltung der damaligen Kirchgänger aber durchaus
repräsentativ. Was da geboten wurde, befremdete die
Zuhörer, weil es nicht den Vorstellungen von einer schlichten, andächtigen
Musik entsprach, sondern Assoziationen an theatralische Opernmusik weckte!
Die Passion Christi aber als eine Geschichte von Leiden und Leidenschaft zu
präsentieren, ja als musikalisches Drama, das starke Leidenschaften -
welcher Art auch immer - zu wecken vermochte, ging eindeutig zu weit. Ganz
offensichtlich hatte der ungenannte Komponist sein Thema verfehlt ...

Summe barocker Musik
Erstmalig wurde Bachs Matthäuspassion während des nachmittäglichen
Vespergottesdienstes am Karfreitag des Jahres 1727 in der Thomaskirche
der Stadt Leipzig aufgeführt. Dort kannte man schon seit 1717
Passions-Oratorien mit Chorgesang, Soli und Instrumentalbegleitung.
Die Tradition, am Karfreitag die Passion nach einem der vier
Evangelientexte mit verteilten Rollen zu singen, ist allerdings noch
viel älter. Sie hat ihren Ursprung in der altrömischen (katholischen)
Liturgie, wurde aber auch von den Lutheranern gepflegt, wo sie eine
bedeutende Weiterenwicklung zur oratorischen Passion erfuhr: unter
Einsatz von Instrumenten, mit dem solistischen, begleiteten Sprechgesang
(Rezitativ) für den "Erzähler" (Evangelisten) und die
Hauptpersonen (Christus, Pilatus), mit Chören (für die Choräle und
die "Volksmenge") und zahlreichen Arien, die formal der italienischen
Barockoper entlehnt waren und in denen die einzelnen Stationen des
Leidens Christi betrachtet wurden. Bach vertonte die Arie der
Matthäuspassion
auf einen Text des unter dem Pseudonym Picander bekannten Dichters Christian
Friedrich Henrici, mit dem er dafür eng zusammenarbeitete. Die pathetische
Sprache und barocke, sehr leibhaftige Bildgewalt mögen uns heute befremden,
boten dem Komponisten damals aber gerade in ihrem Facettenreichtum genau
die passende Vorlage.
Während die affektbetonten Arien für die Zuhörer als subjektive
"Emotions"- und "Identifikations-Brücken" fungierten, dabei das Geschehen
kommentierten und für die Hörer in die Gegenwart hineinholten, stellten die
Gemeindechoräle mit ihren eingängigen, allgemein bekannten Melodien
den Bezug zur "objektiven" Liturgie her. Darüber hinaus boten die Szenen
zwischen Pilatus, Jesus und der Volksmenge Gelegenheit zur dramatischen,
quasi-szenischen Ausgestaltung.
Für einen erfindungsreichen Komponisten wie Bach bot sich also eine breite
Palette an musikalischen Möglichkeiten. Sein Dienstvertrag lautete
diesbezüglich eindeutig: Die Musik sollte so eingerichtet werden, dass
sie nicht zu lang dauere und "nicht zu opernhafftig herauskomme", vielmehr
die Zuhörer zur Andacht ermuntere. Nicht Originalität war gefragt, sondern
solides Handwerk, eben gediegene Gebrauchsmusik für den Gottesdienst.
Keinesfalls aber sollte die Musik zu gelehrt und sinnlich daherkommen,
Ausführende und Hörer überfordern, diese gar um ihre Andacht bringen und
gegenüber den vertonten Texten in den Vordergrund treten.
Solche Einschränkungen aber vertrugen sich nicht mit Bachs Vorstellungen von
einer "regulirten kirchen music", die er - sozusagen in Übererfüllung seines
Amtes - in beeindruckender Menge und Qualität verfasste. Bach war sich über
die Aufgabe der gottesdienstlichen Musik als einer "Diener der Theologie"
sehr wohl bewusst; die Widmung "Soli Deo Gloria" ("Dem Höchsten Gott allein
zu Ehren") über zahlreichen, auch "profanen" Partituren ist dabei
allerdings ebenso wenig eine Floskel wie seine Ansicht, dass der höchste
Endzweck der Musik die "Ergötzung" und "Rekreation des Gemüts" sei.
Denn - so notierte er in seiner persönlichen Bibel - "bey einer
andächtig Musig ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart".
Der besonderen Qualität seiner Matthäuspassion war sich der Komponist
sehr wohl bewusst. 1736 fertigte er eine prächtige Reinschrift der
Matthäuspassion an, in der der Text des Evangeliums mit roter Tinte
hervorgehoben ist; in seiner Familie hieß sie schlicht "die Große
Passion". Alles daran muss für die Zeitgenossen ungewöhnlich gewesen
sein: schon ihr bloßer Umfang (moderne Aufführungen benötigen zwischen
zweieinhalb und drei Stunden, zu Bachs Zeiten kam in zwischen dem ersten
und zweiten Teil noch eine einstündige Predigt hinzu!) und erst recht die
aufwändige Besetzung mit zwei Chören und Orchestern übertrafen alles, was
damals üblich war.
Doch nicht nur der quantitative Aufwand unterstrich den Anspruch des
Komponisten. Auch die Verbindung der unterschiedlichsten musikalischen
Gattungen war in dieser Dichte und Qualität ungewöhnlich. So war aus dem
üblichen schlichten Eingangschor über die Worte "Das Leiden unseres Herren
Jesus Christus nach Matthäus" ein kontrapunktisch dicht gearbeiteter
Doppelchor geworden, in der sich die beiden Ensembles in erregten
Frage-Antwort-Rufen ergingen ("Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
sehet - wen? - den Bräutigam, seht ihn - wie? - als wie ein Lamm!") zu
denen schließlich noch der Choral "O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des
Kreuzes geschlachtet" hinzutrat. Kein Wunder, dass die Hörer hier nicht
mehr folgen konnten, zumal es andernorts durchaus üblich war, die Choräle
mitzusingen. Doch weder hier noch an anderer Stelle war dies bei Bachs
Passion noch möglich, nicht zuletzt wegen der differenzierten Harmonisierung
der ursprünglich schlichten Melodien.

Sinnfülle und Expressivität
Bachs Matthäuspassion ist ein bis in das scheinbar nebensächlichste Detail
durchdachtes Werk: Die reiche Instrumentation (allein drei verschiedene
Oboen-Typen) fungiert ebenso wie die Wahl der Zweichörigikeit, der
Tonarten und der Stimmlagen in den Arien mit den dort verwandten melodischen
"Figuren" als klingendes Symbol, oder besser: als "Klangrede". Selbst die
Zahl der Noten entspringt keinesfalls dem Zufall oder folgt nur
musikalischen Notwendigkeiten. Jedem Partikel des Werkes ist gewissermaßen
die Heilsbotschaft von der Erlösung der Menschen eingeschrieben.
Diese Komplexität mit ihren unübersehbaren Verflechtungen und Überlagerungen
erzeugt einen Überschuss an Bedeutungen und Sinn. So entsteht ein
geistiger, ein kontemplativer Raum, der von einer einzigen Interpretation
kaum zu Gänze ausgeschöpft werden kann. Und vieles, wie z.B.
die Zahlensymbolik, lässt sich überhaupt nicht hörend erfassen, sondern
erschließt sich erst bei der sorgfältigen Lektüre der Partitur. Diese
abstrakte, nur im Geiste zu erfassende Meta-Musik eröffnet eine
transzendente Perspektive, die ausgehend von dem, was mit den Ohren
und dem "Gemüt" vernommen werden kann, in das dahinterliegende, stets
größere und unermessliche Geheimnis Gottes hineinführt.
Mit einer solchen Konzeption steht Bach keinesfalls isoliert da;
sie spiegelt vielmehr zeitgenössisches barockes Denken wieder und schöpft
aus einer langen Tradition. Außergewöhnlich ist allerdings die Konsequenz
und Vollendung, mit der Bach dieses Ideal in Musik übersetzt, und zwar zu
einem Zeitpunkt, als Weltbild und Ästhetik sich im Zuge eines aufgeklärten
Rationalismus fundamental zu wandeln begannen.
Doch ist die gedankliche und musikalische Komplexität von Bachs Musik nur
der eine Aspekt. Seine Matthäuspassion ist ja keinesfalls nur ein
akademisches Lehrstück. Vielmehr gelingt es dem Komponisten, die
gedanklich-reflexiven Elemente, den Affekt und die Ästhetik vollkommen
auszubalancieren, theologische Programmatik und autonomes Komponieren zu
vereinen - und daraus eine "theonome Kunst" (Nicolas Schalz) zu schaffen.
Was den Hörer dabei unmittelbar packt, ist der durch kühne Dissonanzen,
tänzerische Rhythmen sowie eine ebenso
"sprechende" wie "singende" Melodik und harmonische Farben erreichte
religiöse und dramatische Ausdruck. In den Szenen zwischen Pilatus, Jesus
und der erregten Volksmenge schafft Bach eine szenische Verdichtung von
mitunter archaischer Wucht, die das Geschehen unmittelbar gegenwärtig
setzt. Für den damaligen Hörer dürfte es kaum möglich gewesen sein, sich
angenehm erbaut zurückzulehnen; Bachs Musik verstrickte ihn gewissermaßen
in das große Heils- und Erlösungsdrama um Sünde und Tod, Kreuz und Leiden.
Die verstörte Frage der Jünger "Bin ichs?" auf die Ankündigung Jesu, dass
ihn einer von ihnen verraten werde, richtete sich mit Nachdruck auch an
die Zuhörer!
Die bildhafte Expressivität dieser Evangeliums-Inszenierung hat ihr
Pendant in den gefühlvoll-verinnerlichten oder erregten Arien, in denen
der Komponist ein Höchstmaß an affektiver Ausdeutung und zugleich
Subtilität erreicht. Durch die Verflechtung der Motive und
"Figuren" in der instrumentalen Begleitung wird die von den Zeitgenossen
gewünschte nur eindimensionale "Rührung" des Hörers überboten: Stets geht
es um die Tiefendimension des Geschehens, man könnte auch sagen: um die
Frage nach der göttlichen Wahrheit (und zugleich der Worte, der Musik, der
Ästhetik und Empfindungen, die dafür in Dienst genommen werden). Die
Matthäuspassion antwortet auf die Wahrheitsfrage, in dem sie diese
Wahrheit - die Heilsbotschaft, das Evangelium - gleichsam mit jeder
Note verkündet. In dieser radikalen "theonomischen" Verdichtung ist sie,
heute kaum weniger als zu Bachs Zeiten, eine Herausforderung für die
Interpreten wie die Hörer.
Wiederentdeckung 1829: Die Matthäuspassion als romantisches Oratorium
Zu Bachs Lebzeiten wurde das Werk drei- bis viermal aufgeführt, um dann wie
das übrige Vokalschaffen Bachs vom Zeitstil überholt und bis auf wenige
Ausnahmen vergessen zu werden. Eine geplante Wiederaufnahme im Jahre 1739
wurde dem Komponisten vom Stadtrat untersagt, das letzte Mal erklang das
Werk wohl 1742. Insgesamt hatte Bach fünfzehn Jahre an seiner
"Großen Passion" gearbeitet; jede erneute Aufführung brachte kleinere oder
größere Änderungen mit sich, die auch den äußeren Umständen geschuldet
waren. Aufführungspraktisch gesprochen, war es ein "work in progress",
wobei die Reinschrift von 1736 wohl die Ideal-Fassung letzter Hand
darstellt.
Erst 1829, über hundert Jahre nach seiner Entstehung und fast 80 Jahre
nach Bachs Tod, hat das Werk seinen Eingang in das musikalische
"Weltbewußtsein" gefunden. Und zwar in einer vor allem in den Arien stark
gekürzten Bearbeitung durch den damals gerade zwanzigjährigen Felix
Mendelsohn Bartholdy (1809-1847). Um es überhaupt aufführen zu können,
passte er das Werk den Aufführungsbedingungen und der musikalischen Ästhetik
seiner eigenen Zeit an, indem er es in puncto Besetzung(sstärke),
Instrumentation, Tempo, Dynamik und Agogik [= Struktur der Tempi innerhalb
eines Stückes] "romatisierte" - der Beginn der Interpretationsgeschichte
nach Bach.
Denn mit der Aufführungspause waren auch die barocken Aufführungstraditionen
und (ungeschriebenen) -konventionen abgerissen. Das Bachsche Autograph
musste interpretiert und, wo nötig, auch ergänzt oder verändert werden.
Manche Instrumente waren nicht mehr im Gebrauch, so Cembalo und
Laute (Ersatz: Hammerklavier und Harfe) oder, wie die ominöse
"Oboe da caccia", schlechthin unbekannt. Mendelsohn wählte hier die zu
Bachs Zeit noch kaum gebräuchliche Klarinette. Bei späteren Aufführungen
fasste man zudem den sogenannten Generalbass (eine einstimmige, mit
Akkordziffern bezeichnet Bassmelodie, die im Barock das musikalische
Fundament jedes Stückes darstellte) nur noch als eine Skizze auf, die
es auszukomponieren galt (so 1867 in der Fassung von Robert Franz). Zu
Bachs Zeiten hätte man sie mit typischen Generalbassinstrumenten wie
Cembalo, Orgel, Laute oder Cello während der Aufführung anhand der
"Skizze" improvisieren lassen. Auch besetzte Bach seine Passion nur mit
Knaben- und Männerstimmen,
während die Alt- und Sopran-Partien bei Mendelsohns Wiederaufführung von
Sängerinnen übernommen wurden.
Überhaupt: Die vermeintliche Monumentalität der Matthäuspassion war eher
eine Frage der Disposition, nicht der Masse von Mitwirkenden. Bachs
Besetzung wird eher kammermusikalisch gewesen sein, vielleicht mit zwei,
drei oder vier Sängern pro Stimme, möglicherweise hat er seine Passion
sogar nur solistisch, mit acht bis zehn Sängern und zwei kleinen
Kammerorchestern aufgeführt. Mendelssohn verfügte über den großen
gemischten Laien-Chor der Berliner Singakademie (300-400 Mitglieder) und
ein entsprechendes Orchester, bei dem die Streicher deutlich gegenüber den
Holzbläsern dominierten - am Ende dieser Entwicklung steht der dichte,
homogone, aber auch etwas monochrome Mischklang moderner Sinfonieorchester.
In barocken Orchestern war die Klangbalance dagegen noch so ausgewogen, dass
die Klangfarben von Streichern und Holzbläsern individueller, mehr wie
die einzelnen Register einer Orgel, hervortraten. Außerdem sorgten ein
tieferer Stimmton, darmbesaitete Streicher und Blasinstrumente mit
Grifflöchern statt Klappen für ein anderes Klangbild, dass dem sprechenden,
rhythmisch akzentuierten Duktus der Musik entgegen kam. Bachs Behandlung
der Holzbläser wie überhaupt die Differenzierung des Orchesterklangs zeigt
eindrücklich, wie sehr ihn sein Stoff auch hier zu ungewöhnlichen Lösungen
inspiriert hat.
Schließlich aber hatte sich auch das Verständnis des Werkes grundlegend
gewandelt. Mendelssohn und seine Hörer entdeckten
in Bachs Passion die ästhetisch-musikalischen Ideale ihrer eigenen Zeit
gleichsam vorweggenommen: die schon erwähnte Monumentalität und
Weiträumigkeit, erhabenen Ernst und Pathos, aber auch
"Empfindsamkeit", dazu eine reiche, chromatische Harmonik und - als eine
wesentliche Triebfeder romantischer Kunst - die Religion. Oder
besser: eine religiöse Gefühlswelt. Mit der Aufklärung und ihrem
"Prozess gegen das Christentum" hatte die Religion am Ende des
18. Jahrhundert als innerweltlich wirksame, gestaltende Kraft ihre
Bedeutung eingebüßt. Im Zuge der Romantik erlebte sie zwar eine
Renaissance, jedoch mehr als Gegenstand eines subjektiven, innerlichen
Erlebens. Nicht zuletzt wurde das Werk als Denkmal eines deutschen
Musikschaffens national vereinnahmt.
Es liegt in der Konsequenz dieser Entwicklung, dass Bachs Passionsoratorium
nun den Weg aus der Kirche in den Konzertsaal antrat. Es war nicht länger
ein liturgisches Werk, sondern eine religiöse Kunstmusik, die in den
bürgerlichen Konzertbetrieb integriert wurde, genau so, wie man jetzt
Raffaels "Sixtinische Madonna", ursprünglich als Altarbild geschaffen,
andächtig-ergriffen im Museum betrachtete. So lassen sich auch die
willkürlichen Kürzungen verstehen, mit der die Interpreten bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts in die Werkgestalt eingriffen: Sie sind Teil des
Assimilationsvorganges, der ausscheidet, was nicht verwertbar erscheint,
weil es sich der neuen Ästhetik nicht fügt oder weil es nicht mehr
verstanden wird. Mit der Verklärung (und Verunstaltung) des Werkes einher
ging auch die Erhebung seines Schöpfers zum Genie und zum "fünften
Evangelisten", eine Bezeichnung, die Bach sicherlich befremdet, wenn
nicht schockiert haben dürfte.
Die Matthäuspassion "im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit" (W. Benjamin)
Gleichfalls in der Konsequenz einer solchen Säkularisierung liegt es, wenn die Matthäuspassion als
Oper aufgeführt, als Ballett inszeniert (so 1981 vom Choreographen John
Neumeier) und in Adagio- oder Best-of-Compilations angeboten wird. Bach
zum Träumen. Der private Genuss im heimischen Wohnzimmer, der durch die
Schallaufzeichnung möglich geworden ist, markiert gewissermaßen den Gipfel
romantisch-subjektiver Verinnerlichung, aber auch den einer drohenden
Entleerung zum anheimelnden Singsang: "Behüte Gott, ihr Kinder, es klingt
wie in meinem Wohnzimmer!"
Für die Aufführungspraxis bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein
stand in der Regel außer Frage, dass man Bach mit den Mitteln und
Möglichkeiten der eigenen Zeit aufführte und die Aufführungspraxis zur
Bachzeit bestenfalls als Teil der Werkgeschichte zur Kenntnis nahm. So
haben die originalen Besetzungsverhältnisse nur wenige Interpreten daran
gehindert, das Werk mit stetig wachsenden Chor- und Orchestermassen
aufzuführen und die Solopartien opernerprobten Gesangsstars anzuvertrauen,
die der Darstellung ihren unverkennbaren, aber nicht immer adäquaten
Stempel aufprägten.
Dieser unreflektierte und unsachgemäße Zugang ist erst mit der sogenannten
"Historischen Auführungspraxis" (oder "historisch informierten
Aufführungspraxis") einem mehr quellenbezogenen Musizieren gewichen.
Historische Musikwerke sollen unter weitestgehender Berücksichtigung der
Spieltechniken, Instrumente, Besetzungs- und Interpretationsvorstellungen der
Entstehungszeit realisiert werden. Ziel ist dabei eine
"moderne" Interpretation mit den Mitteln der Vergangenheit, keine museale
Rekonstruktion der Uraufführungssituation (die schon deshalb unmöglich
ist, weil beim heutigen Publikum weder die historische Hörererwartung
noch das historische Erleben der Hörer rekonstruiert werden können).
So ist hier auch kein authentischer "Originalklang" herausgekommen.
Eingeleitet wurde vielmehr eine weitere Episode der
Interpretationsgeschichte, die allerdings bis in die Gegenwart bestimmend
ist und ihrerseits Konventionen ausgeprägt hat, die inzwischen historisch
geworden sind. Dass der Anfang der historisierenden Ästhetik durchaus mit
Aufbruchbewegungen im Politischen und Sozialen (68er Bewegung) wie
Mentalen ("authentisch", "handgemacht", "alternativ", "Natur",
"Light-Produkte") korrespondierte, eröffnet kulturgeschichtlich noch manch
kaum untersuchten Seitenpfad.
Dabei kann die angezielte Objektivität der Mittel nur eine relative sein. Im
Fall der Matthäuspassion werden die Verhältnisse u. a. durch die über
Jahre hinziehende Arbeit des Komponisten an dem Werk verkompliziert. Es
liegen zwei Fassungen vor. Die Besetzungsstärke ist nach wie vor
umstritten. Und die verfügbaren Quellen zur barocken Musizierpraxis
lassen genügend Raum für zahlreiche, auch widersprüchliche Interpretationen.
Vieles, was in Bachs eigener Zeit selbstverständlich war, wurde gar
nicht erst schriftlich festgehalten. Die heute gebräuchliche und aus den
Quellen herausdestillierte "Urtext"-Partitur mutet eigentümlich nackt an;
Temporelationen, Dynamik und Phrasierung müssen erst erarbeitet werden.
Auch wurde die doppelchörige Anlage lange Zeit nicht richtig verstanden,
nicht zuletzt deshalb, weil sie aufführungspraktisch ein Problem
darstellt (räumliche Trennung der Ensemble, zwei Orgeln).
So sind hier immer nur Annäherungen möglich - was einer stets neuen,
lebendigen Aneignung freilich entgegenkommt. Mit der Berücksichtigung
aller äußeren Parameter ist jedoch noch nicht die Mentalität des Barock
zurückgewonnen: die angemessene Einfühlung in den Text der Passion bleibt
immer eine besondere Herausforderung. Keine noch so genaue philologische
Kenntnis enthebt moderne Musiker der Notwendigket interpretatorischer
Entscheidungen und Kompromisse. Ein Beispiel: Bachs jugendlich-reife,
im Stil seiner Zeit vorzüglich ausgebildete Knabenaltisten und -soprane
lassen sich heute schon aus evolutionsbiologischen Gründen einfach nicht
mehr reproduzieren: Pubertät und Stimmbruch setzten zu Bachs Zeiten sehr
viel später ein, Bach selbst sang bis zu seinem 18. Lebensjahr Sopran. Heute
ist damit häufig schon mit 12. Jahren Schluss. Doch wie will man von einem
Kind in diesem Alter erwarten, dass es, abgesehen vom technischen Aspekt,
auch den Ausdrucksgehalt der Musik angemessen umsetzt:
"Buss und Reu Knirscht das Sündernherz entzwei, Daß die Tropfen meiner
Zähren Angenehme Spezerei, Treuer Jesus, dir gebären"?
Vielleicht liegt darin auch der utopische, nicht vereinnahmbare Gehalt
von Bachs Musik und ihre anhaltende Faszination. Denn die Fremdheit, die
dem Werk durch die historische Distanz zugewachsen ist, sprengt heute
nicht allein unsere ästhetischen Vorstellungen und Konventionen. Die
ungebrochene Glaubenszuversicht und religiöse Entschiedenheit der
Matthäuspassion, die konträr zum heute üblichen "anything goes" stehen,
berühren und beunruhigen. Oder provozieren. Ob und in wie weit dieser also
dieser utopische Gehalt eingelöst wird, hängt nicht zuletzt von der
jeweiligen Interpretation ab.
Unter den aktuell verfügbaren Aufnahmen lassen sich, will man auch heutigen
Hörgewohnheiten und klangtechnischen Standards Rechnung tragen, drei
Gruppen bilden:
a) Historische Mono-Aufnahmen, die wegen ihrer Klangqualität für die meisten Hörer vor allem von dokumentarischen Interesse sein dürften.
b) Stereo-Aufnahmen, deren Interpreten das Werk mit den Mitteln ihrer eigenen Zeit aufführen.
c) Stereo-Aufnahmen, deren Intrepreten die Konventionen der historischen Aufführungspraxis berücksichtigen. Insbesondere bei jüngeren Aufnahmen ist der Unterschied zwischen der "traditionellen" und "historisierenden" Aufführungspraxis mittlerweile aber nicht mehr so groß.
Ich beschränke ich mich hier jeweils auf einige typische oder herausragende Beispiele:
1. Zwischen "Wagnerismus" und "Neuer Sachlichkeit": Mengelberg und Ramin
Den interpretatorische Spielraum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
markieren exemplarisch die extremen Positionen Willem Mengelbergs und
Günter Ramins.

Für eine spätromantisch breit gelagerte Herangehensweise, die von
der monumentalisierenden Aufführungspraxis des späten 19. Jahrhunderts
herkommt und den Notentext mit größter Freiheit behandelt, ist die Aufnahme
mit dem Amsterdamer Concertgebouw Orchestra unter Willem Mengelberg
von 1939 sicherlich das faszinierendste Beispiel. Ursprünglich auf
Schallfilm aufgezeichnet, ist sie mittlerweile auf zwei CDs
erhältlich (Label: Philips). Mengelberg übersetzt die - beim ihm um
zahlreiche Arien und Choräle gekürzte - Passion in seine Zeit durch eine
massive Orchesterbesetzung, extrem langsame Tempi, romantisch-subjektive
Gesangsmanieren (z. B. ausgeprägtes Vibrato, Verschleifung von Tönen)
und eine für heutige Ohren maßlose, mitunter schockierende Expressivität.
Hier wird die Matthäuspassion zum großen, auf seine Weise konsequenten
Musiktheater in der Tradition eines Richard Wagner.
Eine historisch reflektierte Auslotung der Bachschen Inventionen und
Intentionen darf man freilich nicht erwarten. Sollte man, um mit Friedrich
Hölderlin zu sprechen, die Matthäuspassion jemals für eine
"heilig-nüchterne" Angelegenheit gehalten haben, so wird man hier mit einem
Ausdruckswillen (und -vermögen!) konfrontiert, die in ihrer Zuspitzung
zugleich den Endpunkt einer bestimmten aufführungspraktischen Entwicklung
markieren. Man höre nur die etwas gellende Färbung von Kurt Erbs
Tenor (Evangelist), die Assoziationen an den Kommentatoren-Ton alter
Wochenschauen weckt. Hier gewinnt man interessante Einsichten in die
Universalität einer zeitbedingten Rhetorik. Heute dürften wohl kaum noch
Sänger zu finden sein, die in puncto Atemtechnik und Reaktionsvermögen
dem unberechenbaren Mengelbergschen Dirigat mit seinen spontanen
Tempowechseln - auch innerhalb eines Stückes - gewachsen wären.
Antipode zu Mengelbergs wagnerisierter Passion ist die zwei Jahre später
in Deutschland entstandene, aber erst nach dem II. Weltkrieg verbreitete,
ebenfalls gekürzte Fassung unter Günter Ramin (jüngst auf 2 CDs bei The
Internation Music Company, Hamburg wiederveröffentlich). Die Aufnahme
ist nicht zuletzt Dokument für die Bach-Pflege im 3. Reich. Ramin pflegt,
verglichen mit seinen den Klangvorstellungen der Spätromantik
verpflichteten Kollegen, einen geradezu nüchtern-abgeklärten Bachstil:
das musikalische Pendant zur Ästhetik der "Neuen Sachlichkeit". Er
zwingt der Matthäuspassion nur selten die Emotionalität und plakative
Klanglichkeit eines Mengelberg auf, statt dessen orientiert er sich genau
am überlieferten Notentext. Wenn man so will: Form und Funktion
(oder Partitur und Aufführung) entsprechen hier einander wieder mehr. Dass
dies u. a. im Fall der Rezitative gerade nicht der barocken Praxis
enspricht (hier diente das notierte Taktmaß nur als Orientierungshilfe,
als Ideal wurde
ein am natürlichen Redefluss orientierter Vortrag angesehen) spricht nicht
gegen den wegweisenden Charakter von Ramins Unternehmung, unterstreicht
aber auch noch einmal die Zeitbedingtheit jeder modernen Interpretation
und ihre Abhängigkeit von Erkenntnissen über die historische
Aufführungspraxis. Auch das weithin geübte, die Bachsche
"Klangrede" nivellierende Legatospiel gehört hierhin. Während vor allem
die Sopran- und Altarien auch heute noch durch ihre schlichte,
unprätentiöse - gleichsam objektive - Gestaltung berühren, pflegt der
technisch vorzügliche Evangelist (wieder Kurt Erb) den schon unter
Mengelberg anzutreffenden Vokalstil. Den Basso-Continuo läßt Ramin - damals
noch keine Selbstverständlichkeit - mit einer historisch durchaus legitimen
Kombination von Orgel, (modernem) Cembalo und Cello ausführen.
2. Bach mit den Mitteln der Gegenwart: Karl Richter
Ginge es allein um die Verkaufszahl einer Aufnahme, so dürfte die
Interpretenkrone wohl Karl Richter gebühren. Wobei Richter das Werk gleich
zweimal vollständig für die Archiv-Produktion der Deutschen Grammophon
(DG) eingespielt hat (1958 und 1979, je 3 CDs) und beide Aufnahmen nach wie
vor erhältlich sind. Werbewirksam unterstützt durch seine Plattenfirma, die
ihm zudem die seinerzeit besten Solisten zur Seite stellte, arrivierte
Richter wohl zu DEM deutschen Bachexegeten. Für manche, die mit seinen
Aufnahmen großgeworden sind, ist er noch heute der Maßstab. Dabei markiert
sein Ansatz in etwa den Mittelweg zwischen spätromantischem Pathos und der
Zurückhaltung der Nachkriegsmoderne.
Zwischen diesen Extremen bewegen sich im wesentlich auch die Aufnahmen
der großen Dirigentenpersönlichkeiten bis 1970, ob es sich nun um die
Einspielungen von Wilhelm Furtwängler (EMI 1954), Otto Klemperer (EMI 1961)
oder auch Herbert von Karajan (zweimal: Archipel 1950 / DG 1972) handelt.
Eine gewisse Statuarik, die im Falle von Karajans zweiter Produktion
nahezu bis zum völligen Stillstand der Musik getrieben wird, ist vielleicht
der kleinste gemeinsame Nenner, der diese Aufnahmen auszeichnet. Der
getragene Ton bedient jedoch nur allzu häufig die Klischees von Größe,
Erhabenheit oder vermeintlicher Gefühlstiefe und unterschlägt, unterstützt
durch einen pastosen, dafür wohligen Gesamtklang, Reichtum und Sinnfülle
der Bachschen Musik. Wenn man diese Heransgehensweise auch nicht als
sachgemäß bezeichnen kann, so soll damit doch keinesfalls bestritten werden,
dass diese Einspielungen und entsprechende Aufführungen den Hörern
großartige Erlebnisse verschafft haben und nach wie vor verschaffen.
Für die Beliebtheit der Richterschen Aufnahmen, die obigen Klischees
allerdings auch nicht immer entgehen, dürfte insbesondere die gemessene
Dramatik in Verbindung mit sinfonischer Klangfülle maßgeblich
gewesen sein.

Vor dem Hintergrund, dass Nikolaus Harnoncourt 1970 seine erste
historisierende Einspielung veröffentlicht und damit aufführungspraktisch
ein ganz neues Bachbild inauguriert hatte, wirkt Richters Aufnahme von
1979 freilich wie ein Anachronismus. Ohne die Ernsthaftigkeit und spürbare
Inbrunst der Ausführenden in Frage stellen zu wollen: Die überdimensionierte
Besetzung, die bis zur Erschöpfung (des Hörers) gedehnten Tempi und
klangliche "Spezialeffekte" irritieren heute mehr, als dass sie den Gehalt
des Werkes vermitteln, zumal Richter mit den barocken "Figuren" mancher
Arien offenbar nichts anzufangen weiss und sich auf vordergründige
Virtuosität beschränkt. Ein Beispiel ist die Arie nach dem Selbstmord des
Judas, "Gebt mir meinen Jesus wieder". Diese ist eigentlich Ausdruck
höchster emotionaler Erregung. Die Solovioline, hier sowohl Künderin der
verzweifelten Zerrissenheit wie auch musikalisches Bild für den
hingeworfenen "Mörderlohn" (die dreißig Silberlinge, um Judas Jesus
verriet), die Sündenstricke und letztlich die Schlinge, die sich um
den Hals des Judas legt, ergeht sich in Richters Interpretation in
gemütvollen Kantilenen.
Anderes wird hingegen übertrieben, so die gewaltigen
Basso-Continuo-Orgelakkorde, mit denen das Evangelisten-Rezitativ auf die
Worte "und schlugen ihn auf sein Haupt" endet. Zu einem (durchaus
fragwürdigen) musikalischen Höhepunkt gerät der Chor "Wahrlich, dieser
ist Gottes Sohn gewesen". Breiter als breit, leuchtend und intensiv - man
meint, einen Chorsatz von Johannes Brahms zu hören. Allerdings wird
hier der biblische Text völlig von der puren Sinnlichkeit seiner
ästhetischen Darstellung absorbiert. Man versteht kein Wort, und man muss
offenbar auch kein Wort mehr verstehen - frei nach Wagner ist hier offenbar
Gefühl alles, Erkenntnisse sind nur Schall und Rauch. Also Ästhetizismus
pur, statt den Hörer der Herausforderung des gesungenen Bekenntnisses zu
konfrontieren.
3. Die "große Wende": Nikolaus Harnoncourt und die historische Aufführungspraxis
Nach der Aufnahme der H-Moll-Messe (1968) kam Nikolaus Harnoncourts erste
historisierende Einspielung der Matthäuspassion 1970 (beides Teldec) zwar
nicht mehr unvorbereitet, sorgte aber für großes Aufsehen. Die Reaktionen
reichten von spontaner Zustimmung bis zu heftigster Ablehnung. Man
vergleiche nur seine Auffassung des Eingangschores mit derjenigen seiner
Vorgänger: Mengelberg benötigt 10.54, Richter 9.50 (1958), Ramin
immerhin 8.40 (1939), Harnoncourt hingegen nur noch 7.25 Minuten! 1979
wählt Richter - vielleicht als Reaktion auf Harnoncourt - dann mit
11.6 Minuten demonstrativ ein noch langsameres Tempo.
Geschwindigkeit ist jedoch nur die eine Dimension. Harnoncourt lässt
in Orientierung an Bachs Besetzungspraxis kammermusikalisch verschlankt
musizieren, was schon atemtechnisch ganz andere Tempi favorisiert. Auch
setzt er schärfere Akzente, artikuliert mit lebendiger Dynamik und
kleingliedriger ,sprechender' Phrasierung. Die frühere Massigkeit weicht
einer Durchhörbarkeit, die die Details der Partitur und damit ihre
musikalischen Zeichen hörbar macht. Die Choräle, die früher häufig als
ausgesungene Fermaten die Architektur des Werkes ins Wanken brachten,
werden wieder vom Gemeindegesang her begriffen und natürlich und ohne
falsche Weihe artikuliert. Statt filmmusikalischer Effekte gibt es den
Notentext in ungewohnter Sensibilität und Klarheit zu hören. Dies kommt
nicht zuletzt der Wortverständlichkeit zugute, und vom Wort her - dem
biblischen oder dichterischen - hatte Bach sein Werk ja auch konzipiert und
komponiert.
Dass die Knabensolisten den Anforderungen ihrer Partien dagegen nur
bedingt gewachsen sind, wurde bereits angesprochen.

Um auf das beschleunigte Tempo zurückzukommen: Die Einsicht, dass dem
Eingangschor mit seinem Zwölfachtel-Takt ein tänzerischer
Siciliano-Rhythmus zugrundeliegt, äußert sich bei Harnoncourt in einer
beschwingteren, pulsierenden Darstellung, die das erhabene Trauerportal, das
die romantische Tradition noch in ihm sah, in einen "Hexentanz"
verwandelte - so zumindest die empörten Kritiker. Doch gerade in der
Synthese von bewegter Trauer (Tonart e-Moll, klagende Motivik) und
Trost (bewegter Kontrakpunkt, Pastorale und Tanz im Vorauswissen um
Erlösung und Auferstehung) offenbart sich Bachs vielschichtiges
musikalisches Denken. Genau dieses spannungsvolle Zusammengehen auch
widersprüchlicher Elemente wird in den meisten älteren Einspielungen
unterschlagen. Mengelberg, Klemperer, Karajan und Richter sahen hier
vor allem den beziehungslosen, sich selbst genügenden Traueraffekt.
Harnoncourts vermeintlicher Tabubruch hat sich heute aufführungspraktisch
nicht nur durchgesetzt, sondern nimmt sich seinerseits wieder historisch
aus: 1985 und 1999 hat er das Werk erneut eingespielt (Teldec), im ersten
Fall sogar wieder mit einem konventionellen Orchester. In der Aufnahme
von 1999 wird nicht nur die enorm gewachsene Perfektion im Spiel mit
alten Instrumenten deutlich, sondern auch eine Abkehr von manchen
"Purismen" der Anfangszeit. Die Bögen schwingen wieder gelassener aus, ohne
dass das Ideal einer Klangrede aufgegeben würde. Das in der ersten
Einspielung etwas zarte Klangbild erreicht wieder eine sonore Fülle, bleibt
gleichwohl scharf konturiert und steht im Dienst dramatischer Ausdeutung.
Statt der unzureichenden Knaben singt wieder ein gemischtes Ensemble.
So unausgewogen und technisch unvollkommen die historisierende
Aufführungspraxis zu Beginn manchmal daherkam: Ihre Suche nach
Authentizität hat sich als ausgesprochen anregend erwiesen. Die Mehrzahl
der heutigen Aufführungen folgt mittlerweile dieser Ästhetik, selbst
da, wo mit einem traditionellen Orchester musiziert wird. Bestes Beispiel
dafür ist wohl Helmut Rilling, der die Errungenschaften der
historisierenden Aufführungspraxis für seine jüngste Einspielung der
Matthäuspassion fruchtbar machte (Hänssler Classic).
Darüber hinaus haben sich auch unter den "Historisten" ganz unterschiedliche
Dirigenten-Persönlichkeiten profilieren können, von denen stellvertretend
einige vorgestellt seien:


John Eliot Gardiner als prominentester Repräsentant der britischen
Alte-Musik-Szene konzentriert sich in seiner Einspielung von 1989 ganz
auf das Drama (DG / Archiv). Ein "Oratorienton" wird dabei so
konsequent vermieden, dass das Geschehen vom religiösen Standpunkt aus
unterbelichtet erscheint. Bei aller spieltechnischen Perfektion und
Brillianz bleibt die Darbietung eigentümlich kühl, kalkuliert. Gardiner
scheint über das temporeiche, beschwingte Musizieren zu vergessen, dass
die Worte der Bibel auch zu Bachs Zeiten eine sakrale Aura besaßen, die
zur Geltung gebracht werden wollte. Hier aber geht nichts zu Herzen, trifft
kaum ein Wort - trotz der guten Gesangssolisten. Zudem ist die
Wortverständlichkeit für ein Spitzenensemble wie den Monteverdi-Chor
erstaunlich schlecht.
Gardiner mag forsche Tempi wählen, dennoch bricht in puncto
Geschwindigkeit die Einspielung von Hermann Max und der Rheinischen
Cantorei sämtliche Rekorde; diese vollständige Fassung der Passion
passt auf zwei CDs (Capriccio 1995). Zwar hält der straffe Zugriff die
Musik in stetem Fluss, auch verfügt Max über sehr gute
Solisten (u. a. Christoph Pregadien als Evangelisten). Und sein Chor
und Orchester musizieren luzide und agil, stets ganz nah am Wort und
arbeiten die Details heraus, wobei sie durch eine eher trockene
Kammerakustik unterstützt werden. Davon profitieren besonders die Choräle.
Zum packenden Drama um Heil und Erlösung gerät diese Matthäuspassion trotz
ihrer Gradlinigkeit - oder gerade deswegen - jedoch nicht.

Anders gelagert sind die Aufnahmen des Belgiers Philippe Herreweghe. Er
nimmt das religiöse Anliegen ernst, tendiert aber insgesamt zu einem
kontemplativen Musizieren, dem es manchmal an Expressivität mangelt. Nach
einer bemerkenswerten, sehr verinnerlichten ersten Produktion (1986 Harmonia
Mundi France) spielte er die Matthäuspassion 1999 ein weiteres Mal
ein (ebenfalls HMF). Wie schon bei Harnoncourt, so lässt sich dabei auch
bei Herreweghe in der zweiten Aufnahme eine größere Souveränität und
Gelassenheit im Umgang mit dem historisierenden Apparat feststellen. Die
jüngere Produktion wirkt organischer und auch dramatischer, wobei
die Ausformung der Klangrede in den Arien häufig sehr bestechend ist.
Gleichwohl setzt der Dirigent auch auf atmosphärische klangsinnliche
Wirkungen. Begünstigt wird dies durch ein räumliches, manchmal etwas
halliges Klangbild, das die dunkel timbrierten Instrumente und den
vollen, warmen Chorklang freilich sehr schön zu Geltung kommen lässt.
Allerdings leidet
gerade in Chorälen die Textverständlichkeit darunter. Zwar agiert Josefs
Seligs Christus eher konventionell, während Dietrich Henschels gutturaler
Bass in der tiefen Lage etwas zu massiv ist, aber mit Interpreten wie
Ian Bostridge (Evangelist) und Andreas Scholl (Altus) präsentiert sich
Herreweghes zweite Aufnahme sängerisch auf der Höhe.

Nach ihren "radikalen",
alternativen Anfängen hat sich die historische Aufführungspraxis nicht nur perfektioniert,
sondern ebenfalls auf einem Mittelwert eingependelt, der für die früher
verpönten "Romantizismen" durchaus wieder offen ist. Dennoch darf weiter
mit originellen oder provozierenden Interpretationen gerechnet werden.
Die historische romantische Adaption des Werkes in einer ebenfalls
historisierenden Einspielung bietet Christoph Spering (Opus 111, 2 CD 1992),
der die Mendelsohn-Fassung gewählt hat. Bach im Gewand einer
"authentischen" Romantik, allerdings vor Wagner! Scheinbar ein Paradox, ist
dieses Projekt im Grunde die Folge einer immer weiter expandierenden
historisierenden Aufführungspraxis, die inzwischen bei Anton Bruckner im
späten 19. Jahrhundert angekommen ist. Hier wird nun die
Rezeptionsgeschichte selbst zum Gegenstand einer Rekonstruktion.

Die jüngste Einspielung der Matthäuspassion unter dem Briten Paul McCreesh
bietet das Werk in einer Minimalbesetzung von nur acht Sänger/innen
und zwei sehr kleinen Kammerorchestern. Obschon diese
Ein-Sänger-pro-Stimme-Praxis nicht von allen Bachforschern geteilt wird,
hat sie doch einiges für sich. Ich habe bislang nur Ausschnitte
gehört - und vor allem von großen Eckchören zu wenig - um abschließend
etwas sagen zu könne. Daher gibt es hier lediglich einen ersten Eindruck.
Trotz anfänglich großer Skepsis meinerseits muss ich zugeben, dass
McCreeshs Einspielung (DG Archiv 2003) weder unterkühlt noch dünn
klingt. Beeindruckend ist die Geschlossenheit, die durch das handverlesene
Sänger/innen-Ensemble erreicht wird, das sowohl die Chor- als auch die
Solistenpartien singt. Klangliche Balanceprobleme, die sich in anderen, auch
historisierenden Aufnahmen, bemerkbar machen, stellen sich zu keinem
Moment ein. Schlechthin überragend in der Synthese aus Sanglichkeit und
rhetorischer Durchdringung gestaltet Mark Padmore die Partie Evangelisten:
mit jugendlich-unverbrauchter, farblich und dynamisch enorm wandlungsfähiger
Stimme, kristallklar in der Linienführung, dabei bewegend in seiner
subjektiven Einfühlung.
In dieses Konzept fügen sich auch die jungen Stimmen der übrigen Solisten
ein, die dem Werk etwas von seiner so häufig anzutreffeden altväterlichen
Klanglichkeit nehmen. Und der unpathetische - heilig-nüchterne! -
Jesus von Peter Harvey ist hier wirklich mal ein Mann Anfang dreißig. Den
operhaft-sentimentalen Ton, mit dem die Sänger häufig agieren, findet man
hier offenkundig nicht. Auch die miniaturisierten Volkschöre geraten
überraschend dramatisch, wobei der Mangel an Masse durch Flexibilität und
Präzision wettgemacht wird. Das "Lass ihn kreuzigen" lässt auf seinem
Höhepunkt an hasserfüllter Eindringlichkeit nichts zu wünschen übrig. Durch
die expressive Gestaltung laufen auch die zügigen Tempi nicht ins Leere.
Es scheint, als habe McCreesh hier auf seine Weise Lehren aus
Theodor W. Ardornos Schrift "Bach gegen seine Liebhaber verteidigt" gezogen.
Das ist nur konsequent: Die Sprengung von Konventionen ist ja schon ein
Wesensmerkmal von Bachs Musik selbst!
Georg Henkel